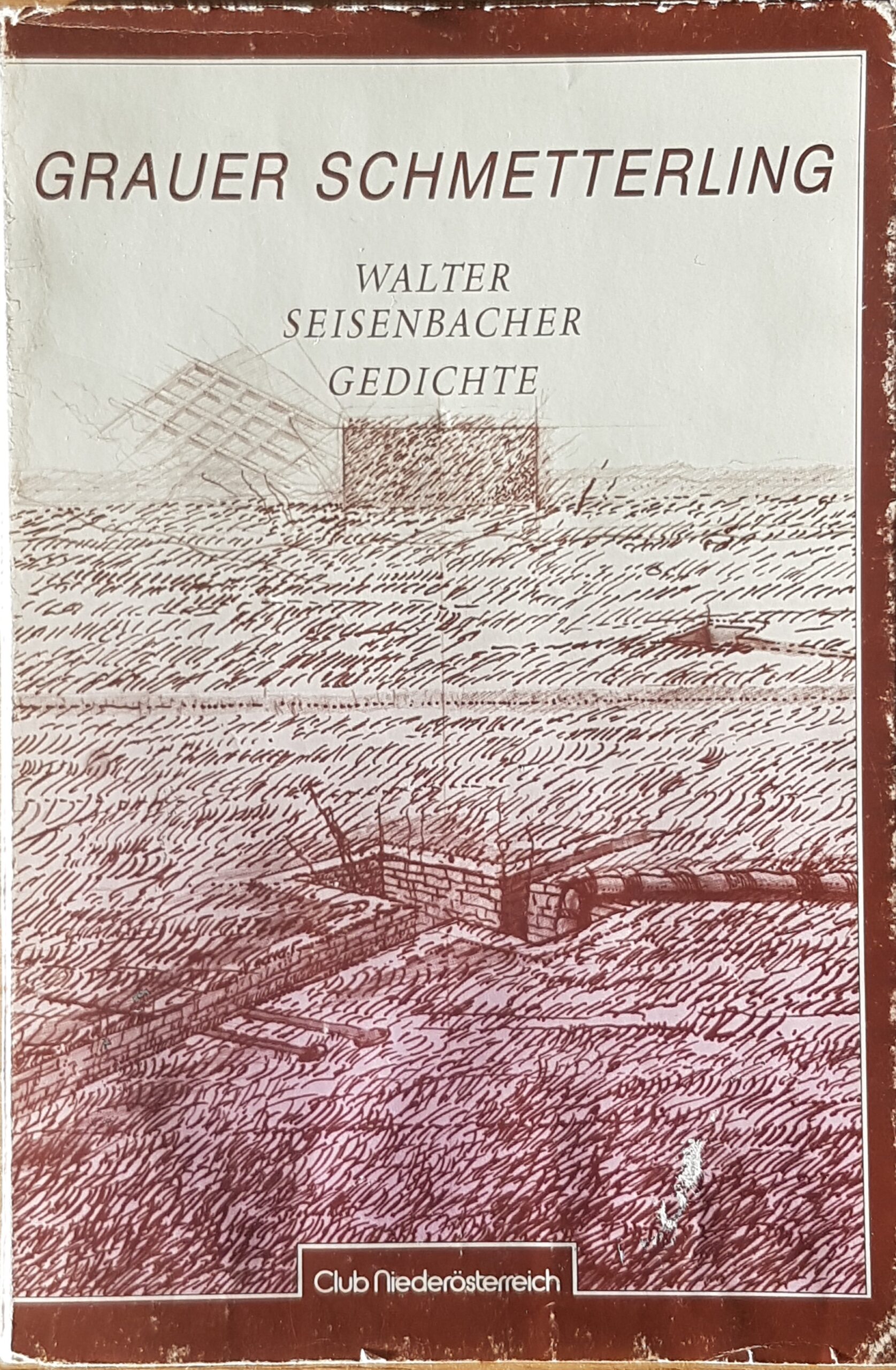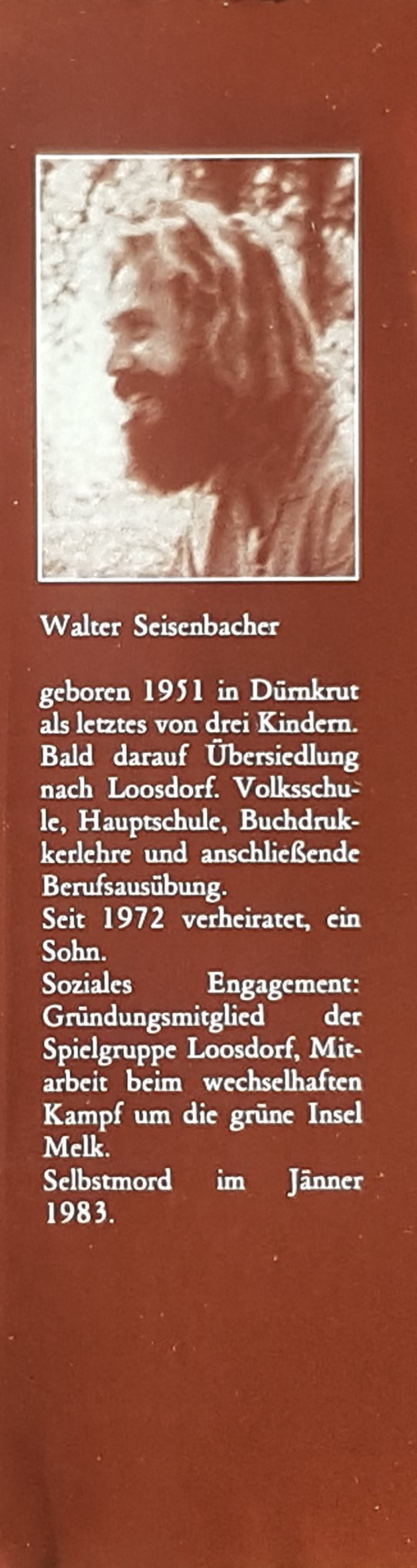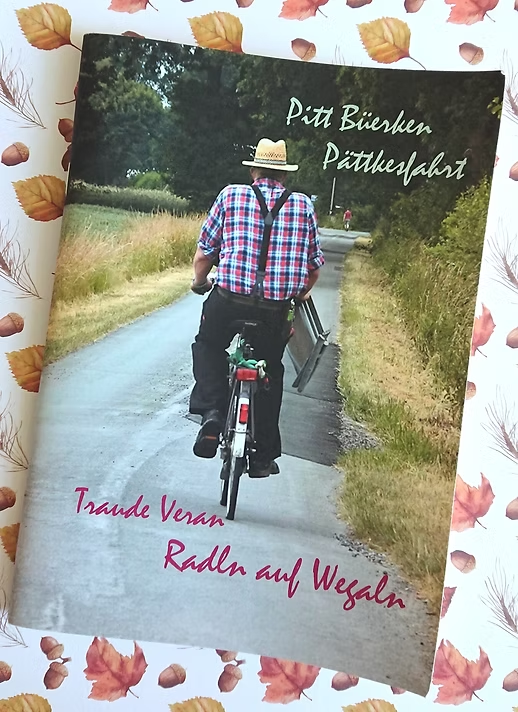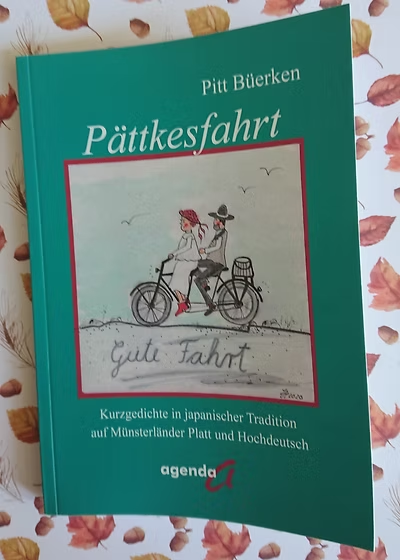»Und kimmt da schwoaze Vogl hea /dem wüll i mi eagebn«

Bernhard C. Bünker | Foto © Micheal Bünker
Bernhard C. Bünkers Poesie im Spiegel von Vor- und Nachworten
von Axel Karner
Bernhard C. Bünker veröffentlichte zu Lebzeiten 12 Lyrik- und 2 Prosabände.
Mit Dazöhl (nix) von daham und der Werkauswahl zommengetrogn erschienen zwei weitere Bücher, in denen Gedichte und Erzählungen, deren Themen sich aufeinander beziehen, formensprachlich unterschiedlich gelöst, eine Einheit bilden. (2)
Er hat stets großen Wert daraufgelegt, seine Publikationen mit Vor- und Nachworten aus dem zumeist kollegialen Umfeld auszustatten. Sie sollten sein Werk unterstützen und seine inhaltlichen Schwerpunkte unterstreichen. Mit zwei Ausnahmen: Im 1976 erschienenen Band mit Dialektgedichten An Heabst fia di verzichtet er ganz auf diese besondere Empfehlung, in der Sammlung A schwoaze Blia fia di setzt er an Stelle des sonst üblichen Begleittextes zwei programmatische Zitate. (3)
Bei der Auswahl der Autoren der Vor- und Nachworte verließ sich Bünker gerne auf den Zuspruch eines freundschaftlichen Urteils. Ist es für seine Märchen und Erzählungen in Ongst vua da Ongst der Theologe und Psychoanalytiker Koloman N. Micskey, der dieser geradezu therapeutischen Aufgabe nachgeht und besonders das Traumhafte in Bünkers Kurzgeschichten hervorstreicht, wählt er für die politisch-programmatische Auseinandersetzung mit Kärnten (Wals de hamat is) den Journalisten Harald Irnberger, der am Beispiel einer unvergleichlichen Menschenhatz gegen Bernhard C. Bünker die politisch-ökonomische Ausnahmestellung Kärntens der ersten Haiderperiode aufzeigt. Im Buch De ausvakafte Hamat ergreift der Freund und Mitstreiter in Sachen Dialektdichtung Hans Haid (verstorben im Frühjahr 2019) – pointierter Kritiker und eloquenter Aktivist gegen einen touristischen »Ausverkauf der Heimat« – das Wort für den »klagenden und schreibenden« Bünker, um seinem Werk trotz inhaltlicher Kompromisslosigkeit und harter Anklage auch eine feine Poesie des »ungemein Zarten,Lyrischen« zu bescheinigen. Fernand Hof[f]mann, Gründungsmitglied des IDI (Internationales Dialektinstitut), ist in seinen Reflexionen zu Bünkers Poesie in Des Schtickl gea i allan überzeugt, dass dessen ursprüngliche, in den frühen Texten ausgedrückte »Anklage, [eine] Revolte gegen eine gesichtslose und entmenschlichte Heimat [ist, die in] der poetischen Form dieser Aussage aus der Enge heraus in die Weite des Weltliterarischen « (4) tritt. Der Schweizer Mundartautor Julian Dillier, der IDI-Mitkämpfer und mit Bünker Herausgeber der Dialektanthologie Manfred Chobot und der erste Ö.D.A.-Geschäftsführer Hans-Jörg Waldner (1988–2003) vervollständigen diese einstweilige Würdigung des literarischen Wirkens Bernhard C. Bünkers.
In der Hauptsache aber übernahm Hans Haid die literarische Einschätzung und eine vorläufige Beurteilung von Bünkers Poesie. Im Nachwort zur Werkauswahl zommengetrogn, Bünkers 1995 letztes zu Lebzeiten erschienenes und bei Carinthia verlegtes Buch, fasst Haid dessen literarisches Wirken noch einmal zusammen und antwortet in einer sehr persönlichen und poetischen Würdigung auf die Frage nach dem, was schließlich von allem übrigbleiben werde, wenn ihn »de oltn freind« verlassen haben werden: »einige davon, da kannst du beruhigt sein, werden die nächsten jahre voller haß, heimatliebe und traurigkeit mit dir gehen, und noch weit mehr davon werden verspätet und erst viele viele jahre nachher diese einzigartige heimatliteratur erkennen.« (5)
Dabei gilt es festzuhalten, dass Bernhard C. Bünker, der seine positiven und negativen Kärntner Erfahrungen in seinen Gedichten, Erzählungen, Märchen, Satiren und Drehbüchern literarisch umsetzte – und sich gerade deswegen als »Heimatdichter« verstanden wissen wollte –, den Begriff »Heimat« als Erfahrung eines sozialen Ortes mit ökologischer und solidarischer Verantwortung neu definierte. Die paradoxe »Geographie« seines »heimatlichen«, von Sehnsucht nach kindlicher Geborgenheit geprägten, zugleich aber unbehaust empfundenen Menschseins bringt das Gedicht die welt ist nicht heimat von Peter Paul Zahl auf den Punkt. Bünker stellte es als Motto seinem Gedichtband Dazöhl (nix) von daham voran:
heimat – das ist eine kette / um den hals ein amulett / ein verlobungs- ein trauring / ein foto der frau der kinder / ein zeitungsausschnitt / heimat ist was du verbirgst / gefährdet sicherheit und ordnung / heimat steckt zwischen den schläfen / pistolenschussbereit / heimweh ist auftrag / heimweh aufruf zum kampf. (6)
Er ersetzte damit den von den Nationalsozialisten vereinnahmten, auf »Blut und Boden« reduzierten und in seiner Menschenverachtung ausgrenzenden, belasteten Heimatbegriff durch ein neues, kritisches Verständnis für ein kulturell-vielfältiges und menschlich-demokratisches Miteinander.
Bernhard C. Bünkers erstes Buch De ausvakafte Hamat (Verlag Friedl Brehm, Feldafing 1975) ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Auswüchsen des Massentourismus in den Alpen als Folge einer maßlos gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prostitution am Beispiel Kärntens. Als gewissermaßen programmatische Grundlegung seines literarischen Schaffens ist für Hans Haid das schmale Bändchen mit 41 Gedichten ein »intensivstes heimaterlebnis« (7), bei dem die einem erzählenden Realismus geschuldeten Gedichte eine »gesichtslose […] entmenschlichte […] von geistigem und materiellem Unrat beschmutzte […] wirkliche heimat« widerspiegeln. Er bescheinigt Bünker eine »tiefe liebe zur heimat […] aus einer ehrlichen sorge« und liest aus Bünkers Texten nicht nur anklagende Kritik, sondern entdeckt, hinter den harten, realistischen Bildern verborgen, auch sein sensibles und emphatisches, lyrisches Talent. Schließlich fordert Haid, selbst Kritiker einer nur an Profitmaximierung orientierten, schrankenlosen und umweltzerstörenden Fremdenverkehrswirtschaft, die Tourismusverantwortlichen auf, zukünftig auf ihren Prospekten Bünkers »kärntner heimattexte « anstelle der gebräuchlichen, verlogenen Werbetexte zu verwenden.
In dem folgenden, 1978 in Klagenfurt bei Carinthia verlegten Prosaband Ongst vua da Ongst, einer Sammlung von düsteren Geschichten und Märchen, bestätigt Koloman N. Micskey in seinem Nachwort Bünker eine »aufwühlend, originelle schriftstellerische Erscheinung «. Er nennt ihn einen »Offenbarer vergehenden, haftenden Dunkels «, dessen Erzählungen den »unhellen Mythos einer vergehend-bleibenden Dorf- und Almenwelt « beschreiben. Bünkers archetypische Bilderwelt erweckt bei Micskey traumähnliche Metaphern als Ausgangspunkt tiefenpsychologischer Deutung: »Das Dunkel beweist das Licht durch Wegweisen und das Bergen durch Verbergen. « (Zitat Micskey) (8)
Im Vergleich einiger seiner Geschichten mit Werken der Weltliteratur konstatiert Micskey bei Bünker eine Meisterschaft und »Souveränität, [mit der er] ein literarisches Motiv umkomponiert «(9) und dieses auf die soziale Welt des Ostalpenraums und im Speziellen der österreichischen Provinz herunterbricht. Dabei erreicht für Micskey der Dialekt »literarisch Würde und Niveau der Hochsprache «.
1979 erscheint unter dem Titel Wals de Hamat is ein Sonderheft der von Antonio Fian herausgegebenen Kärntner Literaturzeitschrift Fettfleck (10) unter anderem als Dokumentation eines »Shitstorms« gegen Bernhard C. Bünker im Zusammenhang mit seinem Aufsatz über das reaktionäre Wesen deutschtümelnder Kärntner, veröffentlicht in der slowenischen Literaturzeitschrift mladje. Das Vorwort dazu schreibt der 2010 verstorbene Kärntner Journalist und Schriftsteller Harald Irnberger, Gründer, Herausgeber und Chefredakteur der österreichischen, politisch-aufmüpfigen Zeitschrift Extrablatt.
Irnbergers Beitrag nimmt eine Sonderstellung unter den Vor- und Nachworten ein, da er sich nicht mit der Poesie Bernhard C. Bünkers und den Inhalten der Gedichte befasst, sondern sich anhand des Aufsatzes über den Sinn und Wert des Kärntner Anzugs bei der ihn tragenden Bevölkerung (Untersuchung zur Korrelation des Kärntneranzuges und dessen Trägern / O razmerju med koroškim gvantom in njegovimi nosilci) mit den besonderen politischen Verhältnissen in Kärnten auseinandersetzt und damit die politische Basis seiner Dichtung, die persönliche Haltung und seinen Antrieb als Autor thematisiert. In Hinblick auf Bünkers Aufsatz und der hysterischen Reaktion darauf (»Es ist kein Zufall, wenn in Kärnten eine Abhandlung über ein gewisses Kleidungsstück zum Kardinalproblem hochstilisiert wird – und man folglich über die tatsächlichen Kardinalprobleme hinwegschweigt.«) verweist Irnberger (Zitat) in dieser Zusammenstellung – erweitert durch politische Gedichte – darauf, wie Bünker von nationalistischen Kreisen zum Feindbild gemacht und sein Aufsatz dazu verwendet wird, um von den realen politischen und ökonomischen Problemen in Kärnten mit seiner Strukturschwäche, den fehlenden Arbeitsplätzen und der Ausgrenzung und Hetze gegenüber der slowenischen Minderheit abzulenken.
Für Harald Irnberger ist der Ausnahmefall Kärnten in seiner exemplarisch besonderen Verbundenheit alter Nazis mit Sozialdemokraten am Fall Bünker, der im Landals »Nestbeschmutzer« und keineswegs als Heimatdichter gilt, projektiv abgehandelt.
Ein Plädoyer für die Dialektlyrik am Beispiel von Bünkers Dialektgedichten hält der Luxemburger Pädagoge, Schriftsteller und Sprachwissenschaftler Fernand
Hof[f]mann in dem 1980, wieder bei Carinthia erschienenen Gedichtband Des Schtickl gea i allan. In einer ausführlichen Analyse (11), betitelt als »Mundartlyrik gegen den Trend oder Der Mut zur Poesie «, stellt er Bernhard C. Bünker ins Spannungsfeld eines unverschuldet schmerzlich Alleingelassenen und eines bewusst entschiedenen »einsamen literarischen Waldläufers«. Hof[f]mann greift in der Betrachtung der Poesie Bünkers – mit einer Ausnahme (»Bünkerische Dialektlyrik «) – auf den Begriff »Mundart « zurück und setzt ihn anstelle des für Bünker so wichtigen Begriffes »Dialekt« als Markierung seiner politischen Intention als Autor. Für Hof[f]mann ist Bernhard C. Bünkers literarischer Weg ein Entwicklungsprozess von anfänglich noch »hörbarer Nähe der Anti-Heimat-Tendenz und des umweltschützlerischen [sic!] Engagements « zu einem politisch nicht mehr engagierten Dichter. Um letztlich aber doch einzuräumen, dass »ein guter Teil dessen, was er schreibt, nur vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten unserer Zeit zu verstehen ist «. Er sieht Bünker weder als »Sprachrohr der bis dahin stummen Volksmassen «, noch als Mundartagitator, vielmehr gewahrt er ihn als einen Autor, der »Poesie um der Poesie willen « schreibt, jedoch anders als in der Theorie des »l’art pour l’art«, als jemanden, der Poesie als »ein Kondensat der Wirklichkeit der Welt versteht «.
Hof[f]mann verortet Bernhard C. Bünker literarisch zweifach: einerseits als einen Kärntner »Heimatdichter « (12), der in »Rückbesinnung auf das, was man ist und wie man es geworden ist im Hinblick auf ein besseres Erkennen und Begreifen der eigenen Person « die Kärntner Wirklichkeit erfasst und beschreibt, andererseits als einen verschwenderischen Menschen, der – in der willentlichen Umklammerung der Welt als Liebender – Lebensgefühl und Welterfahrung als Widerspruch »freudiger Diesseitsbejahung und asketischer Weltflucht, sinnlicher Lebensumarmung und mystischer Todessehnsucht « zu einem »erotischen Erleben« vermengt.
Damit stellt er Bünkers Gedichte in die Tradition klagender Liebeslyrik, und zwar, wie er meint, des aus der Tradition »zwischen Sensualität und Askese gespannten religiös-erotischen Lebensgefühls « schöpfenden Kärntner Liebesliedes. Die Gedichte stellen in ihrer »Art einen vergeblichen und deshalb elegischen Versuch der Weltumarmung« dar. Die »Bünkerische Dialektlyrik« mit ihrem wehmütigen Grundton bleibt so »einerseits fest in seiner Kärntner Heimat verwurzelt, [diese] ja ohne sie überhaupt nicht denkbar ist«, andererseits identifiziert er eine »kosmopolitische Allüre […] im Schatten Baudelaires und Trakls, das heißt einer bestimmten Form europäischer Lyrik «. Und meint, wie ja auch Micskey und Haid, in der literarischen Klage Bünkers über eine »gesichtslose und entmenschlichte Heimat « eine Weltläufigkeit zu erkennen, die zwar von der provinziellen »Motivik und Thematik her begrenzt ist «, aber »in demselben Maße in ihrer allgemeinen Aussage und der poetischen Form dieser Aussage aus der Enge heraus in die Weite des Weltliterarischen « tritt.
In der Einleitung des 1984 bei Heyn erschienenen Gedichtbandes Wonns goa is (13) schlägt Hans Haid einen fast hymnisch-verklärenden Ton an. Für den »Poeten« Bernhard C. Bünker sei »Poesie die Wahrheit «. Er beschreibe zwar in seinen Gedichten Kärnten als eine seelenlose, entmenschlichte Landschaft (»Die Dörfer in der Heimat verlieren die Gesichter […] Weg von der Provinz ins gestaltlose Niemandsland […] Gesichter der Dörfler werden leer und ausdruckslos «) und verwende dazu Bilder und Metaphern, die an das »kurz zurückliegende Erleben seiner Kärntner Heimat « erinnern. Aber im Gegensatz zu den Verantwortlichen und deren Mitläufern, die über den Missständen im Land »ihre Augen verschließen, […] erkennt und erleidet « er als Dichter. »Das Betroffenmachen und Berühren, das Vorausschauen und das Ahnen ist [dabei] die Sache des Poeten. « Und in der Art und Weise, wie er seine literarischen Bilder »poetisch und dialektmäßig « einsetzt, gibt er – auch in enger Verbundenheit mit den Kärntner Slowenen – »seinen Landsleuten die Sprache wieder «.
Für Haid ist Bünker ein »Liebes- und Todeslyriker«, der wie Christine Lavant, die zwar »schriftdeutsch schrieb, aber im Dialekt dachte «, seine Gedichte genauso »bilderreich, verschlüsselt, aus der lebendigen, wirklichen Volkspoesie kommend, in Bildern und Sprache vollwertige Ausdrucksmittel der eigenen Kultur « schreibt. Es sind »die poetischen Bilder einer scheinbar längst entschwundenen Welt «, die »gleichzeitig Dokumente einer hochstehenden Provinzkultur « sind.
Drei Aspekte zeichnen Bernhard C. Bünkers Poesie im deutschen Sprachraum als einzigartig aus: Zum einen ist Bünker »trotz der archaisch-altertümlichen Sprach- und Gedankenwelt modern «, zum anderen spiegelt sich in seinen Gedichten eine »Verhaltenheit und eingehaltene Trauer « wider, die nicht dreinhaut oder niederbrüllt, sondern in ihrer »unterdrückten Wut weint «, die »den Mond und den Wind an seiner Stelle trauern [und] den Tod mit seiner weißen Magd mit weißen Mohnblumen in der Hand kommen « lässt.
Schließlich stehen seine »Liebes- und Todes- oder Todes- und Liebesgedichte […] in einer Art Wahn, in Todessehnsucht und Trauer, aber in großer Intensität. [Es sind] Bilder und Gedanken für das Erlebenkönnen, für das Mitfühlenkönnen und der Traurigkeit «.
Bei Hermagoras erscheint 1991 eine Sammlung von Texten und Gedichten im Kärntner Dialekt mit dem Titel Dazöhl (nix) von daham. Hans Jörg Waldner steuert das Nachwort (14) bei. Er interpretiert Bernhard C. Bünkers Texte als eine »Symbiose von
Poesie und Widerstand.« In dieser Verbindung von epischer Beschreibung und lyrischer Empfindung wird der Leser mit der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit Kärntens konfrontiert.
Die Texte thematisieren die Sehnsucht eines verlorenen und vereinsamten Stadtmenschen (»obgsoffn in da traurigkeit, … «) nach Heimat (»lei ham «), in der sich aber die Vertrautheit und Geborgenheit vorgaukelnden Dörfer seiner Kindheit als desillusionierende Orte der »Angst, Hinterhältigkeit « und Niedertracht entpuppen. Bünkers »daham« sind keine nostalgischen Kindheitsorte, sondern kennen die zerstörerischen »Mechanismen in Industrie, Fremdenverkehr und dem Landleben im Allgemeinen.«
Bei der Frage nach dem soziokulturellen Hintergrund in Bünkers literarischem Werk gelangt Waldner zu einem ähnlichen Befund wie Hans Haid: Die Wut in Bünkers Texten schöpft aus seiner leidvollen Erfahrung des »Kärntnerischen«. Bünker bringt dabei ein zutiefst menschenverachtendes Gemenge literarisch auf den Punkt. Die »Bilder und Metaphern in seinen Gedichten [sind] karg, doch gestochen scharf.« Der Dialekt ist »souverän und kompromißlos «.
Für Hans-Jörg Waldner ist Bernhard C. Bünkers Schreiben über die Heimat kein larmoyantes Gefasel der »Heimatverschönerer« und »Grenzlandkameraden «, sondern die aus seinem sozialen Gewissen angetriebene Zurückführung eines nationalistisch und völkisch vereinnahmten Heimatbegriffs. Die Gedichte und Geschichten, die von unbändiger poetischer Kraft zeugen, ergreifen dabei immer »Partei für Benachteiligte, Gegängelte, Bevormundete «.
Das Nachwort des Basler Mundartautors, Theater- und Radiomannes Julian Dillier zu Nochamol z’rucklafn (Verlag Heyn 1988) vermerkt eine »selbstkritische Inventuraufnahme zum 40. Geburtstag«, eine Art Beichte und Bilanz. Es ist »ein Geständnis ohne Angst « (15), bei dem Bünker nicht bloß zurückschaut, sondern seinen bisherigen Lebensweg zurückläuft, »gewillt, seinen Weg zweimal zu gehen, […] weil es ihm ist, es müsste dies und das anders werden.« Dabei erinnern die aufgesuchten Orte – allesamt Stationen seines Lebenslaufes – an »Kreuzwegstationen« oder an »Rastplätze, auf denen man gerne verweilt, weil sie an Gutes oder vielleicht auch wohltuend an Schmerzliches erinnern «. (16)
Trotz dieser tröstenden und gar heilenden Konnotation, bescheinigt Dillier den Gedichten einen elegischen Grundton. Nur »in wenigen schimmert Zuversicht auf, [etwa] wenn die Rede ist von lieben Kreaturen, von Bienen, Schmetterlingen.« Vielmehr ist für ihn in Bünkers Gedichten »die Rede von Enttäuschungen […] Oft zittert auch Angst mit, etwas zu verlieren, spricht er seinen Monolog über Brüchigkeit der Gefühle, über Freundschaften, erinnert er sich an Erfahrungen, zigeunert [sic!] er durch Landschaften der Traurigkeit, dann wieder durch Landschaften, die ihn an eine Heimat erinnern, wo man sich wohlfühlt, […] der immer noch die KZ-Beule anhaftet.« Um schließlich im pessimistischen Ton zu resümieren: »Es ist nichts mehr wie früher, aufbewahrt bleiben nur die Erinnerungen. « Schwarze Vögel, Kirschbäume im Schatten, schmerzende Schneenadeln, verbrannte Hände.
In dem Auswahlband Lei nit lafn onfongen (mit Schallplatte), 1988 im Krefelder Van Acken Verlag erschienen, meldet sich Hans Haid mit einem Nachwort neuerlich zu Wort.
In seinen Ausführungen zu den Texten in Kärntner Dialekt (17) stellt er Bernhard C. Bünker als einen »aufsässigen, querköpfigen, poetischen Heimatdichter « vor, der auch aus Angst vor »den Marschierern, den braunen Heimatdienstlern, den Betonierern, den Staumauerverbrechern « gegen das große, von diesen verursachte Leid anschreibt. Dabei sich aber selbst aussetzt und exponiert »als Leidender, als Schöpfer, als Künstler, [und] als Rufer « immer »ganz vorne mit dabei « ist. Haid zählt die Gedichte, die von einer »schlichten Bildhaftigkeit wie in allerbester Volkspoesie « getragen sind, zu den besten Dialektgedichten; immer mit Blick auf den vielgestaltigen, kulturellen Hintergrund Kärntens: »Durch und durch slawisch ist die schwere Bilderwelt. « Bünkers Liebesgedichte – Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit – sind für Haid jenen H. C. Artmanns mehr als ebenbürtig.
Haid sieht Bünkers Antrieb zum Schreiben im »Haß und [der] Traurigkeit « eines »Grenzgängers « (»Immer hart an der Drau […] bei den Slowenen, bei seinen Freunden, bei seiner slowenischen Freundin, bei den Schwächeren, den Getretenen, den Grenzgängern. «) gepaart mit einem zerbrechlichen Heimatverständnis (»Konflikt mit der schwarzen Angst und dem braunen, dem deutschnationalen Heimat-Dienst «).
Das Vorwort zu seinen Satiren (Verlag Buchkultur, 1990) verfasst schließlich der langjährige Freund und Schriftsteller Manfred Chobot.(18) Er hält über Bernhard C. Bünker alias Florian Leposchitznig, »Kärntner aus Passion und von Geburt […] «, Folgendes fest:
»Als Heimatdichter hat er sich auch auseinandergesetzt mit den politischen Verhältnissen in seiner Heimat, mit der Vergeßlichkeit mancher Politiker, mit dem, was nämliche Volksvertreter unter Kultur verstehen oder nicht verstehen, denn selbst der genialste Politiker ist auch bloß ein Mensch. […] Bernhard C. Bünker liegt etwas an seiner Heimat, er nimmt Heimatliebe wörtlich und ernst, und er mißbraucht sie nicht als Vorwand, um Ungerechtigkeit und Verlogenheit unter dem verhüllenden Lodenmäntelchen der Heimattracht weiterhin ungeniert zu betreiben. Weil ihm die Heimat am und im Herzen liegt, schreit er und wehrt er sich, verteidigt sie.«
Um im Sinne des Heimatdichters Leposchitznig schließlich zu behaupten: »Der Wirklichkeit ist wirklich nur satirisch beizukommen. « Und letztlich auch nur so zu ertragen.
________________
Anmerkungen
- Bünker verwendet die Verse als Motto in: Nochamal z´rucklafn. Büldaschticklen aus fost viazg Joa. Verlag Heyn, Klagenfurt/[Celovec] 1988. [=Bünker, z’rucklafn]
»Und kimmt da schwoaze Vogl hea / dem wüll i mi eagebn – / Hob donn ka Ongst vuam Schteabn mea / Fiacht mi nit mea vuam Leben […]« (nach einem alten Volkslied) - Nach Bernhard C. Bünkers Tod 2010 wurden bisher vier weitere Bücher mit seinen Texten veröffentlicht.
- Bernhard C. Bünker: Schwoaze Blia fia di. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana, Wien/Dunaj, Hermagoras/Mohorjeva 1993; S.5 [=Bünker, Schwoaze Blia]
»[…] die Welt der Dichter ist nicht die Schöpfung tieferer Einsicht, sondern heftiger Sehnsucht […] «. (Thornton Wilder, Die Iden des März)
»[…] während des Tages versuchte ich den ausgelegten Fallstricken zu entgehen, und die Nächte waren voller unsagbarer Greul […]« (B.[ernhard] C. Bünker, Tagebucheintragungen, Sept[ember] 1979) - Bernhard C. Bünker: Des Schtickl gea i allan. Klagenfurt/Celovec, Carinthia 1980; S.68 [=Bünker, Schtickl]
- Bernhard C. Bünker: zommengetrogn. Werkauswahl. Hrsg. v. Wilfried Gindl. Mit einem Nachwort von Hans Haid. Klagenfurt/Celovec, Edition Carinthia 1995; S.214ff.
- Bernhard C. Bünker: Dazöhl (nix) von daham. Texte und Erzählungen im Kärntner Dialekt. Klagenfurt/Celovec, Wien/Dunaj, Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1991; S.5 [=Bünker, Dazöhl (nix)]
- Bernhard C. Bünker: De ausvakafte Hamat. Friedl Brehm, Feldafing 1975; S.3
- Bernhard C. Bünker: Ongst vua da Ongst. Carinthia, Klagenfurt 1978; S.101 [=Bünker, Ongst]
- Bünker, Ongst aaO. S.102
- Bernhard C. Bünker: Wals die Hamat is. Eine Fettfleck–Sonderausgabe. Herausgegeben von Antonio Fian. Fettfleck – Kärntner Literaturhefte, Spittal a. d. Drau, Wien 1979; S.6ff.
- Bünker, Schtickl aaO. S.66ff.
- Bünker, Schtickl aaO. S.67
- Bernhard C. Bünker: Wonns goa is. Texte im Kärntner Dialekt. Heyn, Klagenfurt 1984; S.5ff.
- Bünker, Dazöhl (nix) aaO. S.166ff.
- Bünker, z’rucklafn aaO. S.112
- Bünker, z’rucklafn aaO. S.111ff.
- Bernhard C. Bünker: Lei nit lafn onfongen. Texte im Kärntner Dialekt. Mit Schallplatte. Van Acken, Krefeld 1988; S.73ff.
- Bernhard C. Bünker: Satiren. Mit einem Vorwort von Manfred Chobot. Verlag Buchkultur, Wien 1990; S.9